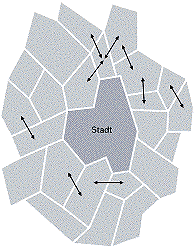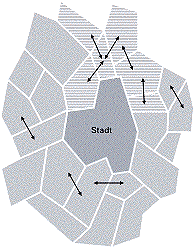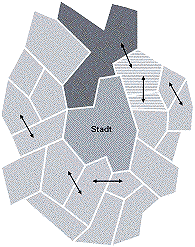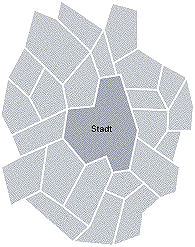4. MÖGLICHE
AUFGABENERFÜLLUNGEN EINER ZWECKGEMEINDE IN
DER AGGLOMERATION
4.1 Verkehrsinfrastruktur
Eine der dringendsten Aufgaben von
Agglomerationsgemeinden ist die Bewältigung
des so genannten Agglomerationsverkehrs. Hier ist
unmittelbarer Handlungsbedarf gegeben, konzentriert
sich doch die Mobilität in hohem Ausmass in
den Städten und ihren
Agglomerationsräumen. Dort sammelt sich der
Berufsverkehr und der Freizeitverkehr (Einkaufen
etc.).
Bis vor kurzem wurde der
Verkehr ausserhalb der Städte noch unter dem
Titel «Regionalverkehr» abgehandelt
[14]. Jedoch enthielt der
Begriff «Regionalverkehr» keinerlei
Aussage über die Art und das
(Immissions)-Ausmass des Verkehrs; insbesondere
lief das Thema Agglomerationsverkehr unter dem
gleichen Obertitel wie zum Beispiel der
Regionalverkehr in den Bündner Alpen.
Dies ungeachtet des Umstandes,
dass ein grosser Teil des so genannten
Regionalverkehrs in den Agglomerationen stattfindet
[15].
Am 19. Dezember 2001 genehmigte der Bundesrat
den Bericht «Agglomerationspolitik des
Bundes» und machte darin deutlich, dass er
künftig einen grösseren Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung der schweizerischen
Agglomerationen leisen will. Der Bund beabsichtigt,
innovative Projekte durch eine gezielte
Anreizpolitik zu fördern. Kurzfristig geht es
darum, das finanzielle Engagement des Bundes in
diesem Bereich zu verstärken. Beiträge
vom Bund für den Agglomerationsverkehr werden
an die Auflagen geknüpft, dass die
betreffenden Agglomerationen eine gemeinsame
Trägerschaft bilden und den Nachweis
erbringen, dass sie ihre Siedlungsentwicklung und
den Verkehr optimal aufeinander abstimmen.
Zur Unterstützung dieser
Bestrebungen soll ein neues Instrument - das so
genannte Agglomerationsprogramm - im
Raumplanungsgesetz verankert werden [16].
Für die Agglomerationsgemeinden bedeutet
dies konkret, dass sie sich für diesen Prozess
rüsten müssen. Dies wird nicht ohne
Schulterschluss der betroffenen Gemeinden geschehen
können. Je intensiver aber dieser
Schulterschluss unter den Agglomerationsgemeinden
ist, umso stärker werden sie sich Gehör
verschaffen können. Für solche
gemeindeübergreifenden Aufgaben sind jedoch
heute keine institutionalisierten
Körperschaften und Instrumente vorhanden,
welche über die bisherige institutionalisierte
Zusammenarbeit (z.B. die Zweckverbände der
Verkehrsregionen) hinausgehen. Bestehende
Plattformen dienen in erster Linie einer
Verstärkung der fachlichen Kompetenz wie z.B.
bei der Abklärung der technischen Machbarkeit,
der rechtlichen Rahmenbedingungen oder der
möglichen Szenarien im Hinblick auf eine
gemeinsame Investition. Hingegen
wird die Dimension der Ermessensfragen, d.h. die
politische Auseinandersetzung bzw. die Frage,
welche Massnahmen zu welchem Preis wünschbar
sind, weit gehend vernachlässigt
[17].
Das Modell der Zweckgemeinden könnte gerade
hier die zentrale Hilfestellung bieten, indem die
öffentlichen Mittel zielgerichtet,
aufgabengerecht und demokratisch fundiert
eingesetzt werden können. Eine zu schaffende
Zweckgemeinde «Agglomerationsverkehr»
(Arbeitstitel) wäre im Stande, eine
agglomerationsgerechte Aufgabenerfüllung
vorzunehmen - dies ohne die Entscheidungskompetenz
an eine obere Ebene (Kanton und Bund) verlagern zu
müssen. Oder mit anderen Worten kann damit die
Zuständigkeit auf lokaler Ebene (bei den
beteiligten Gemeinden) erhalten bleiben.
Gegenüber den heutigen (Verkehrs-)
Zweckverbänden überwiegt der Vorteil der
demokratischen Kontrolle, gepaart mit finanzieller
Transparenz und Gestaltungsfreiheit (Autonomie).
Dieser Prozess muss jedoch von den Gemeinden
ausgehen und darf weder vom Kanton noch vom Bund
diktiert werden.
Mit einer neu gegründeten Zweckgemeinde
«Agglomerationsverkehr» bleibt die
Selbstständigkeit der Agglomerationsgemeinden
bewahrt bzw. wird gefördert. Dem Prinzip der
Subsidiarität wird nachgelebt, und ein
effizienter und zielorientierter Einsatz der
finanziellen Mittel im öffentlichen Verkehr
wie im Individualverkehr wird
gewährleistet.
Das Thema Agglomerationsverkehr kann
selbstverständlich nicht losgelöst von
anderen raumplanerischen Überlegungen
betrachtet werden, zu vielfältig sind die
Verflechtungen heute. Denn die Verkehrsentwicklung
ist eng mit der Siedlungsentwicklung verflochten.
Bis in die 1980er-Jahre wurde sowohl im Bereich des
Hoch- wie des Tiefbaus die Zweckmässigkeit von
Vorhaben einzig auf Grund der Kosten und der Lage
beurteilt. Der Verbrauch der Ressource Boden galt
höchstens unter dem Gesichtspunkt der
Landesversorgung als problematisch.
Seit Beginn der 1990er-Jahre
ist im Bereich der Besiedlung jedoch ein
Paradigmenwechsel feststellbar; die offene
Landschaft soll mit der Siedlungsentwicklung nach
innen, d.h. ohne zusätzliche
Bauzonenbeanspruchung freigehalten werden
[18]. Die
Möglichkeit, im Rahmen einer Zweckgemeinde
weitere Aufgaben zu übernehmen, erweist sich
darum gerade hier als Vorteil.
Diesen methodischen Ansatz hat auch der Bund
gewählt. Er knüpft seine
Unterstützung im Bereich der
Agglomerationsprogramme (frühestens ab 2006
jährlich 300 bis 350 Millionen) an planerische
und organisatorische Bedingungen:
So soll die Verkehrsplanung
immer alle Verkehrsträger umfassen sowie mit
raumplanerischen und umweltpolitischen Zielen und
Massnahmen abgestimmt werden [19].
4.2.
Siedlungsplanung
Am Beispiel der Zürcher
Glatttalgemeinden [20]
lässt sich darlegen, wie stark in den
vergangenen Jahren die siedlungspolitische
Weichenstellung erfolgt ist - und wie auch in
Zukunft die Weichen noch zu stellen sind.
Beachtlich ist der Wandel der Glatttalgemeinden von
den ehemaligen städtischen Vororten zu neuen
urbanen Zentren. Beachtlich sind
auch die realisierten Erschliessungen (z.B.
Oberhauserriet) und der Bau diverser Grossprojekte
(z.B. Stadtbahn Glatttal, «Airport City»,
Überdeckung der Autobahn Opfikon, Hochbord in
Dübendorf, Zwicky-Areal (Neugut) in
Wallisellen [21] etc.).
Im Glatttal wird nicht nur gebaut, sondern hier
entsteht ein neues Zentrum mit eigener
Identität zum Wohnen wie zum Arbeiten. All
diese Projekte wurden durch den kantonalen
Richtplan «Siedlung und Landschaft» aus
dem Jahre 1995 begünstigt, welcher einen
grossen Teil dieses Raums zu «Zentrumsgebieten
von kantonaler Bedeutung» erklärt hat
(Zürich Nord inkl. Oberhauserriet, Teile von
Kloten, Opfikon, Wallisellen und
Dübendorf).
Diese Entwicklung bringt aber nicht nur Vorteile
für die Glatttal-Gemeinden. Insbesondere der
zunehmende Individual-verkehr und der Flugverkehr
erzeugen auch ernst zu nehmende Immissionen und
Belastungen für den Lebens- und
Wirtschaftsraum Glatttal. Es entsteht ein
Spannungsfeld zwischen boomender Entwicklung und
einer immer grösser werdenden Abwehrhaltung
gegenüber neuen Infrastrukturen. Hier ist die
Raumplanung mehr denn je gefordert.
Fortsetzung...
Anmerkungen
[10]
Bezirke sind keine
Gebietskörperschaften, sondern
beschränkt zuständige
Verwaltungseinheiten.
...weiterlesen
^
[11] Vgl. zur
Regionenfrage auch THIERSTEIN, A.; WALKER, D.;
BEHRENDT, H. et al. (1997): Tatort Region -
Veränderungsmanagement in der Regional- und
Gemeindentwicklung. Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden.
...weiterlesen
^
[12] Dieses
Datum entspricht dem geplanten Fahrplan des
Verfassungsrates zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses.
...weiterlesen
^
[13] Vgl. auch
Art. 47 bis Abs. 1 KV: Wo besondere
Verhältnisse es als wünschenswert
erscheinen lassen, können sich die
Gemeinden mit Genehmigung des Regierungsrates
miteinander zu Zweckverbänden verbinden, um
einzelne Zweige der Gemeindeverwaltung
gemeinschaftlich zu besorgen.
...weiterlesen
^
[14]
Regionalverkehr im hier verwendeten Sinn
hat nichts mit den heutigen und als
Zweckverbände ausgestalteten
Verkehrsregionen zu tun!
...weiterlesen
^
[15] Dr. Max
Friedli, Direktor Bundesamt für Verkehr,
anlässlich des Symposiums
«Stadtverkehr - wie weiter?» vom 2.
April 1998.
...weiterlesen
^
[16]
Medienmitteilung des Bundesrates vom 19.
Dezember 2001 «Bundesrat lanciert
Agglomerationspolitik des Bundes».
...weiterlesen
^
[17] Vgl. zu
diesem Thema auch BEZ, Baurechtsentscheide
Kanton Zürich, 2002, Nr. 54:
Gemeindeübergreifende Lösungen in der
Verkehrsplanung sind nur sehr eingeschränkt
möglich. Gemeinden haben den
innerörtlichen (Erschliessungs-)Verkehr
soweit möglich über ihr eigenes Gebiet
abzuwickeln. Nur wenn dies nicht oder allenfalls
bloss unter erheblich erschwerten Bedingungen
möglich ist, kann eine Gemeinde über
das Gebiet einer benachbarten Gemeinde
führen.
...weiterlesen
^
[18] Zitat
Zürcher Umweltpraxis ZUP, Nr. 31, September
2002, S. 30, aus Beitrag «Kann die
Verkehrsplanung von der Siedlungsplanung
lernen?».
...weiterlesen
^
[19]
Medienmitteilung des Bundesrates vom 18.
Juni 2002 «Startschuss für
Agglomerationsprogramme».
...weiterlesen
^
[20] Die
Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon,
Dübendorf, Kloten, Opfikon, Rümlang,
Wallisellen und Wangen-Brütisellen haben
sich unter der Bezeichnung «glow. das
Glattal» - www.glow.ch
- eine gemeinsame Plattform gegründet.
Auslöser dafür war eine besonders
dynamische Entwicklung in den betroffenen
Gemeinden. Für diese Gemeinden stellen sich
auch wichtige Fragen der Raum- und
Siedlungsentwicklung und der
Infrastrukturplanung (Flughafen, Glatttalbahn
etc.).
...weiterlesen
^
[21] In
Dübendorf und Wallisellen wird im Dezember
2002 getrennt über öffentliche
Gestaltungspläne für einen neuen
Stadtteil mit 4000 Arbeitsplätzen und 400
Wohneinheiten abgestimmt. Der Gestaltungsplan
über das gesamte Grundeigentum Neugut
erfasst Flächen in der Gemeinde Wallisellen
und in der Stadt Dübendorf. Beide
Gemeinwesen sind im kooperativen Planungsprozess
beteiligt gewesen. Der private Gestaltungsplan
will eine qualitativ hoch stehende Planung
anstreben. Insbesondere soll mit dem
Gestaltungsplan das überörtliche
Potenzial besser genutzt werden können
(vgl. Weisung bzw. Antrag des Gemeinderates
Wallisellen zuhanden der Gemeindeversammlung vom
11. Dezember 2002).
...weiterlesen
^
|